„Micha der mal da war“
Madhava – oder wie ChatGPT es einmal transkribierte: „Micha, der mal da war“.
Ein Name, der so klingt, weckt fast automatisch Fragen. Manche Menschen lächeln, andere runzeln die Stirn, viele fragen einfach: „Was bedeutet das eigentlich?“ oder „Wie kommt man zu so einem Namen?“
Solche Fragen begleiten mich, seit ich diesen Namen trage. Und sie sind nicht immer leicht zu beantworten – vor allem dann, wenn der Rahmen fehlt, um die Geschichte in ihrer Tiefe zu erzählen. Lange Zeit lag der Name sogar „in der Schublade“. Nicht nur, weil er so ungewohnt war, sondern auch, weil ich spürte, wie schnell ein spiritueller Name mit Missverständnissen belegt wird: „Ah, jetzt ist er was Besonderes …“ oder „Jetzt ist er völlig abgedriftet …“.
Und dann gibt es auch jene, die den Weg des Sannyas wirklich gehen – für die ein Name eine Einweihung, ein Gelübde, ein Zeichen spiritueller Hingabe ist – und die meinen Zugang vielleicht eher belächeln oder für zu leicht genommen halten könnten.
Dieses mögliche Befremden – von beiden Seiten – arbeitete eine Weile in mir, genährt von jenen Anteilen, die noch viel toxische Scham in sich tragen.
Heute ist das anders. Ich trage den Namen bewusst – und möchte hier einmal in Ruhe erzählen, wie er zu mir kam, was er in der hinduistischen Tradition bedeutet und warum er für mich mehr ist als ein Etikett. So können Klienten, Freunde und alle, die sich dafür interessieren, die Geschichte in einem Stück lesen.
Kindheit & der Name Michael
Mein bürgerlicher Name ist Michael Müller – ein Name, der in Deutschland kaum häufiger vorkommen könnte. Als Kind und Jugendlicher in Bayern war ich der „Michi“ oder der „Michl“. Keiner dieser Namen fühlte sich stimmig an.
Im Gegenteil: Der Name Michael trug für mich etwas Profanes, Austauschbares, das mich innerlich an eine Stelle drängte, an der ich nie sein wollte. Ein 08/15-Name für jemanden, der nicht 08/15 sein wollte. Und dieser Name nährte, ohne dass ich es damals klar hätte benennen können, meine innere toxische Scham. Er wirkte wie ein Etikett, das ständig daran erinnerte, wie sehr ich mich nach Einzigartigkeit sehnte – und wie weit ich mich davon entfernt fühlte.
Die erste Verschiebung – Micha
Erst Anfang zwanzig begann jemand, mich „Micha“ zu nennen. Und plötzlich war da ein Einverständnis. Kein tiefer Frieden – aber ein Moment von „Oh, das klingt aber schön.“ Zum ersten Mal konnte ich mich vom ungeliebten „Michael“ distanzieren.
Ich konnte mich dabei beobachten, wie ich in dieser Zeit Menschen manchmal etwas rüde – oder je nach Laune auch sanfter – darauf hinwies, wenn ich mich als „Micha“ vorgestellt hatte und sie aus Automatismus doch wieder „Michael“ sagten. Dann machte ich unmissverständlich klar, dass ich so nicht genannt werden wollte.
Auch wenn ich mit „Micha“ meinen Frieden gefunden hatte, schlummerte die alte Unzufriedenheit weiter – wie eine unterirdische Quelle, die sich immer wieder bemerkbar machte.
Der Funke für eine größere Veränderung
Jahre später saß ich in einem Kirtan-Workshop. Ich hatte mich damals aufgemacht, Harmonium zu lernen – ein Vorhaben, das nicht weit über den Anfang hinausging. Irgendwann, zwischen Gesang und Pausen, erzählte ich einer Teilnehmerin meine Geschichte: die Unzufriedenheit mit „Michael“, die kurze Erleichterung durch „Micha“, und dieses alte Gefühl, mit einem Namen zu leben, der für mich so gar nicht schwingt.
Am Ende des Workshops drückte sie mir wortlos einen zusammengefalteten Zettel in die Hand. Als ich ihn später öffnete, stand dort:
„Hier bekommst du einen neuen Namen.“
Satsang, Pari – Nürnberg
Im europäischen Mantra-Universum sind Satyaa & Pari kein unbekanntes Duo. Ihre Bhajans gehören in vielen Kreisen zu Mantra-Abenden. Pari kommt aus der Linie von Papaji, einem indischen Meister der Advaita-Tradition, und gibt Satsangs – Begegnungen in Stille, Gespräch und Präsenz.
Ich kannte ihn bis dahin nur vom Namen. Aus Neugier sah ich mir einige seiner Videos an. Ich mochte die Ausstrahlung, die Wärme in der Stimme, und die Haltung, die durch seine Worte schimmerte. Auch die Musiker des Abends waren mir vertraut. Also beschloss ich zu gehen – ohne zu wissen, warum, aber mit der leisen Bereitschaft, mich auf etwas Ungeplantes einzulassen.
Der Satsang
Der Raum war schlicht: Stuhlreihen im Halbkreis, in der Mitte ein Stuhl. Pari saß dort, barfuß, in weißer Kleidung – eine Mischung aus Ruhe und Wachheit. Der Abend begann unspektakulär: Fragen, Antworten, viel Raum.
Ich hob die Hand: „Ich bin hier, um möglicherweise einen neuen Namen zu bekommen. Würdest du das tun?“ – „Ja, selbstverständlich. Komm nach vorne.“
Ich ging durch die Reihe und kniete mich vor ihn. Wir waren auf Augenhöhe. Und dann begann etwas, das nicht geplant, nicht besprochen und nicht inszeniert war.
Wir sahen uns an – nicht die Oberfläche, nicht die Persona, nicht die Geschichten. Es war ein Blick in eine innere Landschaft, die wir offenbar beide kannten. In diesem Blick geschah etwas Seltenes: Wir erkannten uns. Es war dieses stille, zweifellose Wissen, das manchmal im Leben auftaucht – eine unverrückbare Wahrheit. Ich sehe dieses Wesen. Und ich werde gerade selbst gesehen.
Zwischen uns begann ein leises Lächeln, das sich zu einem offenen Anlachen ausweitete. Freude darüber, einander in diesem Raum zu begegnen. Und nur deshalb, nur aus dieser Begegnung heraus, konnte der Name überhaupt Bedeutung haben. Hätte mir jemand einfach einen Namen gegeben, ohne dass dieses Erkennen beiderseits stattgefunden hätte, er wäre leer geblieben. Aber hier kristallisierte sich der Name aus etwas, das jenseits von Wille oder Absicht lag.
Als die Freude sich legte, sagte er: „Ich gebe dir den Namen Madhava.“ Er schrieb ihn auf einen Zettel und notierte die Bedeutung: Süßer Honig.
Der Zettel in der Schublade
Zu Hause lag der kleine Zettel auf dem Schreibtisch. „Madhava“ in Handschrift, darunter: Süßer Honig. Ich schaute ihn an wie ein Fundstück aus einer anderen Welt. Etwas in mir war überwältigt – und zugleich wusste ich nicht, was ich mit diesem Namen anfangen sollte.
Vielleicht war es die Intensität des Augenblicks. Vielleicht auch die Ahnung, dass dieser Name keine neue Visitenkarte war, sondern eine Einladung, der ich mich nicht halbherzig stellen konnte. Also wanderte der Zettel in eine Schublade. Nicht versteckt, nicht weggeworfen – eher wie ein Same, der an einem sicheren Ort aufbewahrt wird, bis die Zeit reif ist.
Erste, zaghafte Schritte
Monate vergingen. Manchmal zog ich den Zettel heraus, las den Namen, ließ ihn in mir nachklingen. Aber ich sprach ihn kaum aus.
Erst in Seminaren von Learning Love wagte ich, den Namen zu benutzen. Dort war es üblich, einander mit spirituellen Namen anzusprechen – ein geschützter Rahmen. Ich hörte, wie andere „Madhava“ sagten, und prüfte in mir, was es mit mir machte. Außerhalb blieb ich „Micha“. Nicht aus Verleugnung, sondern weil die Welt da draußen Namen wie „Madhava“ oft nicht versteht – und weil nicht in jedem Gespräch Zeit ist, den Kontext zu erzählen.
Die langsame Annäherung
Mit den Jahren veränderte sich meine Arbeit. Ich wurde klarer darin, wofür ich stehe: Menschen in ihrer Verletzlichkeit zu begleiten, ihnen zu helfen, wieder Zugang zur Süße des Lebens zu finden – ohne das Schwere zu leugnen. Irgendwann erkannte ich, dass genau das in meinem Namen steckt: Madhu – die Süße; Wissen – nicht trocken, sondern als verlässliche Erkenntnis, die Sicherheit schafft; und die Verbindung zum Weiblichen, zum schöpferischen Prinzip – nicht nur als Bild, sondern als Haltung.
So begann ich, „Madhava“ auch in meinem beruflichen Wirken zu verwenden. Erst zögerlich, dann selbstverständlicher.
Zwei Namen, zwei Landschaften
Heute leben beide Namen in mir – aber sie bezeichnen nicht dasselbe Land.
„Micha“ steht für den konditionierten Teil: geprägt durch die narzisstisch geformte Persönlichkeit meiner Mutter, durch die Abwesenheit meines Vaters, durch gesellschaftliche Erwartungen. Es ist der Name, der sich in der Welt der Religion und der Funktionalität bewegt, der in formellen Kontexten funktioniert, wo Anpassung und Rollen gefragt sind. Er trägt auch verletzte Anteile – die gelernt haben, nicht aufzufallen, wenig Raum einzunehmen, sich ins System einzupassen.
„Madhava“ gehört zu einer anderen Landschaft: Er ist Ausdruck meines authentischen Wesenskerns, jener inneren Quelle, aus der ich – so gut es mir gelingt – in Sessions, Seminaren und Begegnungen wirke. Der Name erinnert mich daran, dass ich auf dieser Reise bin: immer wieder zurückzufinden in diese Haltung, aus diesem Kern heraus zu sprechen, zu handeln, zu begleiten.
Diese Qualität lebe ich auch in meiner Partnerschaft – oder versuche sie zu verkörpern. Für mich, der die Idee der Polarität schätzt, ist „Madhava“ auch eine Erinnerung an maskuline Präsenz, die Klarheit und Sicherheit für das Feminine schafft. Gerade in der Intimität wird diese Haltung zum Prüfstein: Hier zeigt sich, ob das, wofür ich stehe und was ich lehre – Liebe lernen (nach Krishnananda & Amana Trobe, Learning Love Institute), Verletzlichkeit leben und in Verbindung bleiben – tatsächlich Praxis ist.
Die Bedeutung von „Madhava“
„Madhava“ ist einer der vielen Namen Krishnas – und in der hinduistischen Tradition tragen diese Namen nicht nur poetische Bilder, sondern ganze Bedeutungswelten. Jeder Name verweist auf eine bestimmte Qualität, eine göttliche Facette, die erfahren und verkörpert werden möchte.
Wörtlich abgeleitet aus madhu („Honig“, „Süße“), steht „Madhava“ für die nährende, lebensbejahende Süße, die das Leben in seiner ganzen Fülle schmecken lässt. In bhaktischen Schriften wie Jayadevas Gīta Govinda ruft Radha ihren Geliebten mit den Worten „yāhi Mādhava, yāhi Keśava“ – „Komm, o Madhava, komm, o Keśava“ – und deutet damit die intime, hingebungsvolle Beziehung zwischen der göttlichen Seele (Radha) und dem Absoluten (Krishna) an.
Eine weitere Deutung von „Madhava“ verweist auf Wissen – nicht im intellektuellen Sinn, sondern als tiefes, verkörpertes Erkennen der göttlichen Ordnung (Madhu-vidyā in den Upanishaden). Dieses Wissen schenkt Orientierung, Klarheit und Sicherheit – eine Qualität, die in der Bhakti-Tradition immer mit Herzintelligenz verbunden ist.
Schließlich bedeutet „Madhava“ auch „Gemahl der Göttlichen Mutter“. In der klassischen Theologie ist damit Vishnus Verbindung zu Lakshmi gemeint – der Göttin des Wohlstands und der Fürsorge. In der Gaudiya-Vaishnava-Tradition, die besonders die Liebe zwischen Krishna und Radha betont, ist Radha selbst die ursprüngliche Shakti – die weibliche, schöpferische Energie des Göttlichen. Krishna – als „Madhava“ – verkörpert das reine Bewusstsein (Purusha), Radha die göttliche Energie (Shakti), und beide bilden zusammen das schöpferische Prinzip allen Lebens.
So steht „Madhava“ zugleich für Süße, Wissen und Einheit – für die göttliche Polarität von Bewusstsein und Energie, männlich und weiblich, Präsenz und Hingabe.
Wer ist eigentlich Krishna?
Falls dich das nicht interessiert, kannst du diesen Abschnitt einfach überspringen. Differenziertheit ist mir wichtig, daher hier ein kurzer Überblick.
- Krishna – in der Vaishnava-Tradition die höchste Form Gottes (Svayam Bhagavan), Ursprung aller göttlichen Erscheinungen oder Avatare.
- Vishnu – erhält das Universum; in einer modernen Analogie: Krishna als Eigentümer & Gründer, Vishnu als CEO.
- Brahma – Schöpfergott, der die Formen des Universums gestaltet; man könnte sagen: der kreative Architekt.
- Shiva – Transformierer oder Zerstörer, der Zyklen schließt und Raum für Neues schafft – der kosmische Erneuerer.
- Shakti – das weibliche Prinzip, die Energie, ohne die nichts existieren oder wirken könnte. Zuordnung: Vishnu ↔ Lakshmi, Brahma ↔ Sarasvati, Shiva ↔ Parvati / Durga / Kali.
- Radha – in der Gaudiya-Vaishnava-Sicht die ursprüngliche Shakti, Verkörperung reiner Liebe und Hingabe – die Seele der göttlichen Beziehung.
In diesem Bild ist Krishna – und damit „Madhava“ – die Quelle, aus der alles hervorgeht. Brahma erschafft, Vishnu erhält, Shiva transformiert; doch Krishna ist der Grund, warum es überhaupt Schöpfung gibt. Er ist das Bewusstsein selbst, das sich in der Liebe zu Radha erkennt.
Ein Name, der eine Geschichte trägt
Wenn ich heute meinen Namen höre oder ausspreche – Micha Madhava oder einfach: Madhava –, klingt in mir mehr an als nur eine Silbenfolge. Ich höre den stillen Augenblick im Satsang, das Lachen zweier Männer, die wussten, dass sie einander erkannt hatten. Ich sehe den kleinen Zettel vor mir, auf dem der Name stand, und spüre, wie er jahrelang wie ein Same in mir ruhte, bis er zu keimen begann.
Ich erinnere mich an die Süße, die dieser Name bedeutet, an das Wissen, das er trägt, und an die Verbindung zum weiblichen Prinzip – zu Radha, zur Shakti, der schöpferischen Kraft des Lebens. Und ich weiß: „Madhava“ ist für mich eine ständige Einladung – in meiner Arbeit, in meinen Beziehungen, in meiner Partnerschaft –, mich immer wieder an meinen authentischen Wesenskern zu erinnern.
„Madhava“ ist für mich nicht nur ein Name. Er ist eine Landkarte zwischen zwei Landschaften – der konditionierten und der freien – und erinnert mich an die Richtung, in der ich gehe. Er ist Prüfstein und Einladung zugleich: dass das, wofür ich stehe und was ich lehre – Verletzlichkeit zu leben, Liebe zu lernen, Verbindung zu halten, am Nervensystem orientiert und durch Selbstmitgefühl den Herausforderungen des Lebens begegnen – gelebte Praxis bleibt.
Vielleicht macht genau das einen Namen lebendig: nicht, wie er klingt, sondern aus welchem Raum heraus er geboren wurde.
Mehr über meine Haltung, meinen Weg und das, was meine Arbeit prägt, findest du auf meiner Über-mich-Seite – dort wird spürbar, aus welchem Raum mein Wirken entsteht.
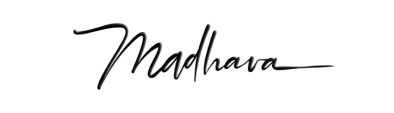







Eine Antwort